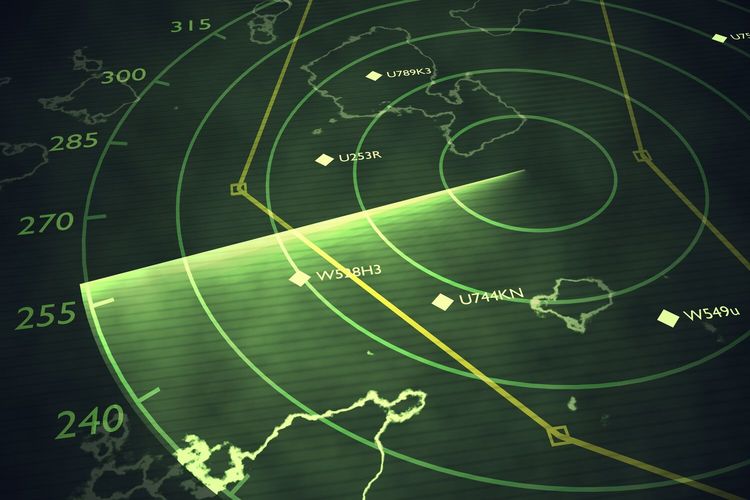Wer die Schaumschlägerei in den sozialen Medien während den letzten Wochen verfolgte, konnte den Eindruck erhalten, die Schweiz sei kurz davor, zu einem «Schurkenstaat» zu werden – das ist Unsinn. Im Kriegsmaterialgesetz ist klar verankert, dass die Schweiz eine an die Bedürfnisse ihrer Landesverteidigung angepasste industrielle Kapazität aufrechterhalten soll. Es ist zentral, dass die Schweiz im Rüstungsbereich über Leistungsfähigkeit und Know-how verfügt – das ist unabdingbar für die Selbstverteidigungsfähigkeit und die Souveränität der Schweiz. Gleichzeitig ist für die FDP aber auch klar: Wir werden niemals etwas unterstützen, was gegen die humanitären, neutralitätsrechtlichen und aussenpolitischen Grundsätze der Schweiz verstösst.
Der Hintergrund
Um was geht es eigentlich? Der Bundesrat hat im Juni 2018 einen Richtungsentscheid zur Anpassungen der Bewilligungskriterien in der Kriegsmaterialverordnung (KMV) getroffen. Ziel der Änderungen des Bundesrates ist nicht etwa, wahllos Waffen in Kriegsgebiete zu schleusen, wie es gerne von linker Seite dargestellt wird. Das dürfte der Bundesrat gar nicht, denn die Schweizer Gesetzgebung gehört auch nach der Anpassung zu den weltweit strengsten im Rüstungsbereich.
Die Anpassung wird vorgenommen, weil die heute bestehende Regelung bei Ländern mit einem internen Konflikt undifferenziert ist. Eine differenzierte Einzelfallprüfung ist gemäss KMV in diesen Fällen gar nicht erlaubt, wäre aber notwendig. Dabei geht es nicht um Staaten wie Syrien, Jemen oder Afghanistan, wo flächendeckend Gewalt herrscht - Exporte in diese Länder bleiben nach wie vor absolut tabu und das ist auch richtig so.
Prüfung im Einzelfall
Anders liegt der Fall beispielsweise bei Mexiko oder Thailand – wo jährlich tausende Schweizerinnen und Schweizer ihre Ferien verbringen. Hier gibt es regionale Konflikte mit Aufständischen, doch sind diese Staaten souverän und haben das Recht, sich zu verteidigen. Die Anpassung der Kriegsmaterialverordnung soll es ermöglichen, im Einzelfall zu prüfen, ob ein Export zum Beispiel nach Thailand erlaubt werden darf oder nicht. Der Bundesrat soll die Bewilligung erteilen dürfen, wenn er zum Schluss kommt, dass ein Rüstungsgut nicht in einem internen Konflikt verwendet und nicht für Menschenrechtsverletzungen missbraucht werden kann. Dabei kann es sich um Geschütze für die Marine, Radarsysteme oder auch um ein Flugabwehrsystem handeln. Letztere sind reine Verteidigungsinstrumente, das gar nicht offensiv eingesetzt werden können. Sie dienen allein dem Zweck der Selbstverteidigung, falls Thailand angegriffen wird. Dieses Recht wird man Thailand kaum absprechen wollen. Weiterhin verboten bleibt hingegen offensives Gerät, das in der Konfliktregion eingesetzt werden könnte. Das soll auch so bleiben.
Mediale Nebelpetarden
So weit, so klar. Leider wird in den Medien aber fälschlicherweise eine Verbindung hergestellt zwischen der Anpassung der Kriegsmaterialverordnung und dem Export von Handgranaten im Jahr 2003 in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Da die VAE kein Bürgerkriegsland sind, konnte der Export damals bewilligt werden. Vermeintlich aus Syrien stammende Bilder von Handgranaten stellten aber die Frage im Raum, ob die VAE das Material unrechtmässig weitergaben. Die Weitergabe von Kriegsmaterial ist klar widerrechtlich und zu verurteilen. Können vertragliche Bestimmungen dies nicht unterbinden, müssen andere Massnahmen ergriffen werden.
Das SECO hat mögliche widerrechtliche Weitergaben der VAE bereits 2012 untersucht. Obwohl bis heute nicht mit absoluter Sicherheit gesagt werden kann, ob es sich bei den Handgranaten auf den Bildern tatsächlich um Schweizer Material in Syrien handelt, hat der Bundesrat seine Exportbewilligungspraxis angepasst und verschärft. Es ist absolut richtig, dass bei Exporten etwa in den Nahen Osten seither noch genauer hingeschaut wird. Das Verbot, Güter weiterzuverkaufen, wurde verschärft. Wenn ein hohes Risiko besteht, dass Güter an unerwünschte Empfänger weitergegeben werden, wird die Ausfuhr abgelehnt. Ausserdem werden seit diesem Vorfall Kontrollen im Endbestimmungsland vorgenommen.
Kontrolle ist streng
Das zeigt: Die Ausfuhrbewilligungspraxis ist in den letzten Jahren deutlich restriktiver geworden. Auch die Kriegsmaterialverordnung wurde mehrfach verschärft (2009: Einführung von Ausschlusskriterien, 2012 Einführung von Kontrollen im Endbestimmungsland). Die Behauptung der Linken, dass die bürgerlichen Bundesräte und Parteien willkürlich Waffen in Bürgerkriegsländer exportieren wollen, stimmt so ganz einfach nicht. Der Bundesrat hat betont, dass die Verordnungsanpassung nicht im Widerspruch zu den humanitären, menschenrechtlichen, neutralitätsrechtlichen oder aussenpolitischen Grundsätzen der Schweiz steht. Die Gesetzeslage ist und bleibt streng. Zudem untersteht der Bundesrat der parlamentarischen Kontrolle durch die GPK, die über alle Rüstungsexporte informiert ist - das Parlament wird keine fragwürdigen Exporte zulassen.
Bericht der EFK ist politisch gefärbt
Im Zusammenhang mit dem Kontrollsystem ist auch auf den Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle einzugehen. Der Bericht wird gerne als Beweis für eine zu lasche Bewilligungs- und Kontrollpraxis beigezogen, obwohl er zunächst einmal festhält, dass alle Exporte korrekt geprüft und bewilligt wurden. Trotz diesem Befund kommt der Bericht zu einem negativen Fazit. Der Bericht hat deutlich eine politische Schlagseite. Das äussert sich etwa dann, wenn er die Kontrollen von ausgeführtem Kriegsmaterial im Bestimmungsland (Post Shipment Verification, PSV) als unwirksam kritisiert. Im Gegensatz dazu beurteilt der Bundesrat diese Kontrollen als sehr wirkungsvoll. Die Schweiz ist im Übrigen weltweit eine Vorreiterin in diesem Bereich! Der Nutzen der PSV wird international anerkannt und andere europäische Länder sind im Begriff, ähnliche Instrumente einzuführen. Auch das zeigt: Die Sensibilität in der Schweiz für Rüstungsexporte ist hoch und die Ausfuhrpraxis wird auch in Zukunft restriktiv gehandhabt.
Damian Müller, Ständerat LU